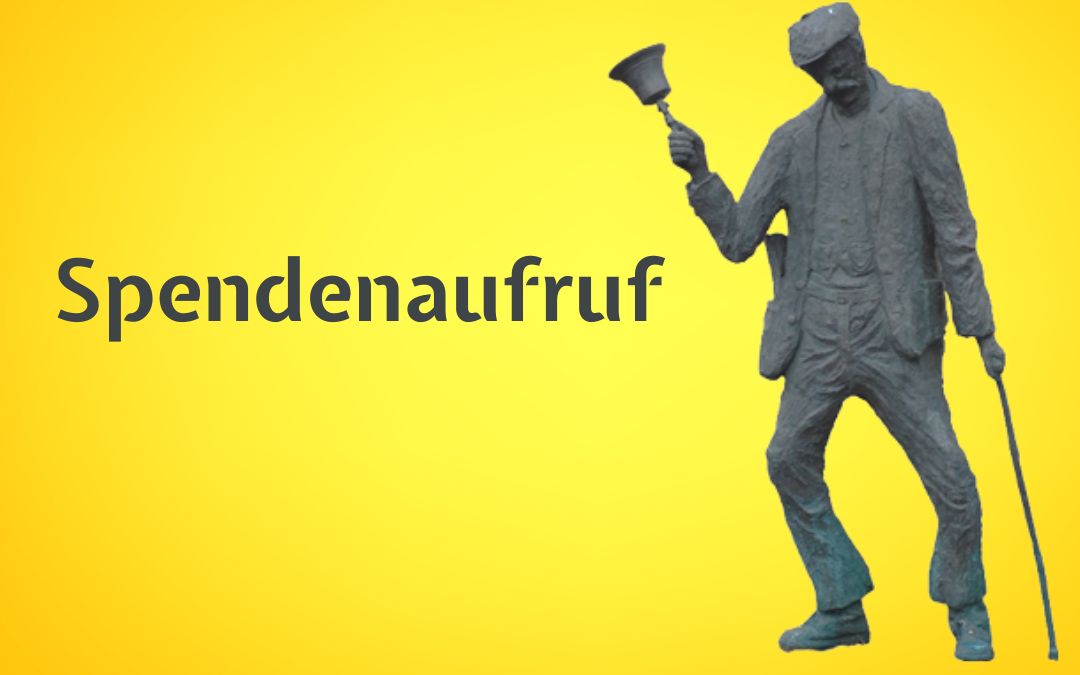Ein Alpener Original
Die Gemeinde Alpen hat sich entschlossen eine weitere Bronzestatue auf dem Gemeindegebiet, in der Ortsmitte von Alpen, zu errichten – dazu eine erläuternde Steele.
Mittlerweile ist die Finanzierung der Statue zu 76% bereits gesichert, durch eine Förderung des Landes NRW, dem Eigenanteil der Gemeinde Alpen (Ratsbeschluss am 18.02.2025), Stiftungen und weiteren Zusagen. Die restlichen Beträge sollen durch Spenden erbracht wer-den, wobei der Junggesellenschützenverein 1680 Alpen e.V. sich bereit erklärt hat, seine Konten dafür zur Verfügung zu stellen.
Die „Spenden-Botschafter Bronze-Staue“ unter der Leitung von Karl Hofmann werden die Bürgerinnen und Bürger unter Zuhilfenahme dieses Schreibens ansprechen bzw. anschreiben, und damit um eine Spende bitten.
Diese Spenden stellen das „Bürgerschaftliche Engagement“ der Alpener Bürger dar, wobei auch die Arbeitskraft oder das Bereitstellen von Baumaterial sowie Bau-Maschinen sowie Arbeitskapazität sehr willkommen sind!
Die Projektleitung sowie die daraus erwachsenen Tätigkeiten werden in ehrenamtlicher Funktion von Herrn Karl Hofmann wahrgenommen, so dass Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nicht übermäßig mit zusätzlichen Aufgaben belastet werden. Die Statue soll in der Mitte von Alpen aufgestellt werden, den Bürgern in Lebensgröße und sozusagen „auf Augenhöhe“ im Alltag begegnen.
Wenn alles nach Projektplan läuft, könnte bereits zum Ende des Jahres die Bronzestatue feierlich der Öffentlichkeit übergeben werden, vielleicht sogar schon am 09. November 2025, dem 160 Geburtstag von Heinrich Graeven.
Mit der Bronzestatue „Der letzte Ausrufer von Alpen“ verbinden sich verschiedene Anliegen:
Der letzte Ausrufer von Alpen
Heinrich Graeven war ehrenamtlich Ausrufer in Alpen, welches er in der Zeit von ca. 1910, mit Unterbrechung in der belgischen Besatzungszeit (1918-1928), bis ca. 1930 als letzter seiner Zunft ausübte.
Ehrenamt
Er wohnte und wirkte zeitlebens in der Mitte von Alpen. Vor allem war er im Jungge-sellen-Schützenverein 1680 Alpen e.V. über 70 Jahre aktives Vereinsmitglied, in ver-schiedenen Funktionen. Bemerkenswert, Im Jahr 1904 war er Schützenkönig mit sei-ner Königin Sibilla Osser. Sie war jüdischen Glaubens und Schwester von Adolf Os-ser, Schützenkönig 1902. Zeitlebens Junggeselle hat er noch bis kurz vor seinem Tod den Schützenverein ehrenamtlich unterstützt.
Ein Alpener Original
Darüber hinaus war er in der Bevölkerung sehr beliebt, insbesondere, wie Zeitzeugen berichteten, bei den damaligen Kindern, die hat er nämlich mit seinem gewaltigen Schnauzbart und seiner ständig wiederholten Floskel „Rätta -Plü“ sehr beeindruckt. In der Nachbetrachtung stellt er ein echtes Alpener Original dar.
Alles zusammen genommen stellt Heinrich Graeven in seiner Person über die Bronze-Statue ein Stück erhaltenswerter Alpener Kulturgeschichte dar. Er war in seiner Zeit einzigartig als Ausrufer, Bürger im Ehrenamt und ein Alpener Original. Bescheiden und aus kleinen Verhält-nissen stammend soll er auch eine Würdigung des Ehrenamtes darstellen, um damit heutige Bürger zu motivieren ihm nachzueifern.
Somit wird Erinnerung zu einem Schritt in die Zukunft!
Kontakt:

Karl Hofmann
Tel.: +49 (0) 2802 2200 Mobile: +49 (0) 1759302711 carlo.hofmann@t-online.de
Und für alle die mehr über Heinirch Graeven wissen möchten hier noch mehr Infos und geschichtliches:
Der letzte Ausrufer von Alpen – Ein Alpener Original
Allgemeines zur Person
Heinrich Graeven wurde 1865 in Alpen geboren. Er lebte und wirkte in Alpen und war von ca. 1915 bis 1930, der letzte Ausrufer beim damaligen Amt Alpen. Heinrich Graeven entsprang „kleinen Verhältnissen.“ Sein Vater war von Beruf Schuster, der seine Werkstatt im Hinterhof des damaligen Hauses Mauerstraße 8 in Alpen betrieb. Mir seinen Eltern und seinen 4 Schwestern (alle ebenfalls kinderlos) wohnte er in einem kleinen Haus in der damaligen Mauerstraße Nr. 8 (heute Alte Kirchstraße) in Alpen (dem damaliger Kreis Mörs (heute Moers geschrieben).
Schon früh lernte er in der katholischen Schule Alpen, Lesen, Schreiben und Rechnen, was ihn später zum Nebenamt des Ausrufers in Alpen befähigte. Heinrich lernte zunächst bei seinem Vater ebenfalls den Handwerksberuf des Schusters, übte diesen aber nie aktiv aus. Er war beim Amt Alpen als so genannter Wegearbeiter (heute würde man sagen, Mitarbeiter beim Bauhof) beschäftigt und übte später von ca. 1915 bis 1930 das Nebenamt des Ausrufers aus.
Der Ausrufer hatte die Aufgabe, amtliche Nachrichten und wichtige Verfügungen an die Bevölkerung Alpen mündlich zu verbreiten. Er benutzte dazu eine Handglocke, um damit auf sich und damit auf die zu verbreitende Nachricht aufmerksam zu machen. Es gab festgelegte Zeiten an bestimmten Tagen, an denen „normale, nicht eilige Nachrichten“ verbreitet wurden. Dazu gab es auch so genannte eilige Sondermeldungen, die dann zumeist an einem oder mehreren Orten ausgerufen wurden. In Alpen gab es offenbar mehrere Stellen, die von den Bewohnern „Et Krütz“ genannt wurden, zum Beispiel Ecke Burgstraße/Haagstraße (heute der fußläufige Durchgang Hotel Burgschänke zur Haagstraße) oder die Ecke Bruckstraße/Mauerstraße (gegenüber den früheren Kolonialwarengeschäft Simes).
Zeit seines Lebens war Heinrich Graeven ledig und kinderlos. Jedoch war er Kindern sehr zugetan, was sich u.a. durch seine oft gegenüber den Kindern wiederholte Floskel „Rätta Plü“ sowie seine Freigiebigkeit mit Süßigkeiten für Kinder ausdrückte. Auch wurde er in den 1930er und 40er Jahren wegen seines immer noch gewaltigen Schnauzbartes (im Volksmund „Kaiser-Wilhelm-Bart“) von den Kindern bestaunt. Heute würde man ihn als „positives Unikum“ und damit als „Original“ bezeichnen, vielleicht sogar ein wenig medial verehren. Weil er sein Leben lang unverheiratet blieb, konnte er sehr lange als Junggeselle Mitglied im Junggesellen-Schützenverein 1680 Alpen e.V. wirken. In diesem Verein hatte er über eine sehr lange Zeit fast alle Vereinsämter und -Funktionen innen. 1904 war er sogar Schützenkönig mit seiner Königin Sibilla Osser (leider bisher kein Foto), wobei das Besondere an seiner Königswürde in den Jahren 1904 bis 1905, seine auserwählte Königin, Sybilla Osser war. Sie war nämlich jüdischen Glaubens, entstammte der alteingesessenen jüdischen Familie Osser (vormals abgespalten von Oster/Ostermann) in Alpen. In besonderer Weise wird hierdurch „geradezu vorbildhaft,“ dass damals eher problemlose Zusammenleben der nichtjüdischen Bevölkerung Alpens und den Mitbürgern jüdischen Glaubens dokumentiert.
Begründung
Durch seine Tätigkeit als Ausrufer und durch seine langjährig wahrgenommenen Ehrenämter im Junggesellen-Schützenverein war er in Alpen bekannt und beliebt, später insbesondere auch bei den Kindern. Die Tätigkeit in der Funktion des Ausrufers verlangten, in gewisser Weise, einerseits amtliche Würde, andererseits den Respekt der Bevölkerung gegenüber der ausübenden Person. Heinrich Graeven hatte sich bis zu seinem 50. Lebensjahr in vielen ehrenamtlichen Funktionen diesen Respekt und das Vertrauen seiner Mitbürger erworben.
Er verkörperte „in besonderer Weise“ die Würde eines Ausrufers und den Respekt der Alpener Bürger des selbstlosen Ehrenamtlers.“
Er lebte immer in der Mitte Alpens in der Nachbarschaft Mauerstraße („Achter de Mur“); war dabei stets hilfsbereit, für seine Mitmenschen nahbar und leicht zu erreichen. Sein Umgang mit Menschen anderen Glaubens war vorbildlich; übertragen in „die Jetztzeit“ kann er in besonderer Weise als Vorbild dienen, für die momentanen Bemühungen „Fremde Menschen anderen Glaubens und anderer Kulturen“ in unser Gemeinschaftsleben zu integrieren. Die Erinnerung durch eine Bronze-Statue an den körperlich „eher kleinen Menschen Heinrich Graeven,“ der als Ehrenamtler viel für den Zusammenhalt in der damaligen Gemeinschaft bewirkte und auf charmante Art und Weise wichtige Neuigkeiten in seinem Nebenamt verbreitete, soll als Brücke in unsere heutige Zeit verstanden werden.
Erinnerungskultur, richtig verstanden und dargestellt, ist auch immer ein Schritt in die Zukunft.
Die Statue soll daher an den Ausrufer und Menschen Heinrich Graeven erinnern, an sein Leben und sein Wirken. Die Statue soll aber auch die vielen unspektakulären, vorherigen und heutigen, Ehrenamtler symbolisieren, besonders die, die mit ihrem Tun nicht immer im Vordergrund standen und stehen. Die Statue soll ausdrücken, dass jeder mit seinen Fähigkeiten und seien sie noch so unbedeutend einen Beitrag zum Erhalt unserer Gemeinschaft leisten kann.
Damit bringt die Staute gleichzeitig den „Dank der Gemeinschaft an das Ehrenamt“ zum Ausdruck.
Merkmale und Ausdruck der Statue
Wie schon gesagt, Heinrich Graeven war eher klein und zierlich; er benötigte aber Kraft für seine überwiegend körperliche Tätigkeit als Wegearbeiter. Die Kraft hatte er sicherlich, als gelernter Schuster! Als „ein Mann aus dem Volke,“ wie man so sagt, war er beliebt und anerkannt. Seine Originalität drückte sich auch durch seinen Spitznamen „Gräves Henneken“ aus. Die Statue soll deshalb ebenerdig, sozusagen „geerdet“ aufgestellt werden. Auf Augenhöhe mit uns heutigen Bürgern und soll uns „in der Mitte Alpens,“ buchstäblich, begegnen. Vielleicht auch an einem schönen Ort zum Verweilen einladen, um darüber nachzudenken, um zu motivieren selbst im Ehrenamt tätig zu werden.
Die Staue sollte einen menschlichen Körper im Alter von über 60 Jahren zum Ausdruck bringen, der über die vielen Berufs- und Lebensjahre sehnig wurde und sichtbar gealtert ist. Der mit Stolz und Würde, jedoch auch in fröhlicher Bescheidenheit, sein Nebenamt ausführte.
Die Größe der Gocke, im Verhältnis zur körperlichen Erscheinung mit dem so gewaltig erscheinenden Schnauzbart, sollen seine „witzige, teilweise schrullige Eigenart“ durchaus zur Geltung bringen, um so die Unverkennbarkeit von Heinrich Graeven als „Alpener Original“
darzustellen. Dabei könnte die über seinen Kopf erhabene und schwingende Glocke, historisch abweichend das „neuzeitliche Wappen der Gemeinde Alpen“ tragen.
Eine zusätzliche Info-Tafel (Stele) könnte – in der Nähe oder daneben aufgestellt – eine Kurzbiografie von Heinrich Graeven enthalten.
Geschichte und Geschichten aus dem Ortsteil Alpen
Heinrich Graeven (1865-1949), der letzte Ausrufer von Alpen
von Karl (Carlo) Hofmann
Er war der letzte Ausrufer Alpens. Dieses Nebenamt führte er bis in die 1930er Jahre des letzten Jahrhunderts aus. Seine „Bühne“ war die Ecke der Kreuzung Wallstraße Bruckstraße – direkt vor dem damaligen Geschäft des täglichen Bedarfs von Jakob Siemes. Die Kreuzung wurde von den Anwohnern der Mauerstraße, Kirchstraße, Bruckstraße sowie weiterer Straßen im Viertel „et Krüz“ genannt.
So haben wir uns kennengelernt.
Die Idee, die Geschichten, um die historische Figur des letzten Ausrufers von Alpen zu erzählen, kam mir bei meinem Renteneintritt im November 2020.
Zum einen herrschte Pandemie, zum anderen kümmerten meine Frau und ich uns um ihre betagten Eltern.
Viel Zeit also, um bei und mit den Eltern Fotos und Bücher anzuschauen. Dabei erzählte meine Schwiegermutter Else (Elisabeth) Theuner immer wieder von „Gräves Hen“, der von sich selbst behauptete, er sei der letzte Ausrufer von Alpen gewesen. Er soll einen gewaltigen Schnurrbart gehabt und ständig die Floskel „Rätta Plü“ benutzt haben, was auf das Kleinkind Else großen Eindruck gemacht habe. Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist ihr aber bis heute rätselhaft.
Meine Neugier war geweckt, und so begann ich mit meinen Nachforschungen. Eine erste Entdeckung waren Fotos und Texte aus Jubiläumsbüchern des Junggesellen-Schützenvereins 1680 e.V. Alpen. Freundliche und vor allem hilfreiche Unterstützung kam von der Archiv-Mitarbeiterin Uschi Hünsch bei der Gemeinde Alpen. Hier konnten u.a. eine Geburts- und Sterbeurkunde, sowie die Feststellung der Wohnorte und auch der Nachweis erbracht werden, dass Heinrich Graeven tatsächlich bei der Gemeinde Alpen (damals „Amt Alpen-Veen“) beschäftigt war. Je weiter ich forschte, desto mehr traten spannende Zusammenhänge zutage. Ihr – und nunmehr auch mir – gingen das rätselhafte „Rätta Plü“ und sein Urheber nicht mehr aus dem Sinn.
Was macht ein Ausrufer?
Ich zitiere aus Wikipedia, Januar 2023: „Ein Gemeindediener war ein haupt- oder nebenberuflich Beschäftigter einer Stadt oder Gemeinde, dessen Aufgabe die mündliche Verbreitung (Umsage) amtlicher Bekanntmachungen und sonstiger Angelegenheiten in einem Ort war. Da die Gemeindediener häufig eine Glocke oder Schelle mit sich führten, um auf sich aufmerksam zu machen, wurden sie in manchen Gegenden auch Ausrufer oder Ausscheller genannt. Durch diese Funktion war der jeweilige Gemeindediener eine allgemein bekannte Persönlichkeit. In vielen Orten gehörte auch die Überbringung von amtlichen Schreiben oder sonstigen Verwaltungs- Schriftstücken zu den Aufgaben des Gemeindedieners.“
Die Funktion des Ausrufers wurde in den Gemeinden am Niederrhein im 19. Jahrhundert eingerichtet und entsprach in etwa dem heutigen „Amtlichen Mitteilungsblatt“, gab es doch bis um 1900 nur äußerst selten ein Telefon, geschweige denn ein Smartphone mit den heute üblichen und viel genutzten sozialen Medien. Auch konnten sich nur wenige Menschen eine Zeitung leisten, abgesehen davon, dass es erst viel später Regionalteile mit amtlichen Bekanntmachungen in den Tageszeitungen gab. Amtliche Nachrichten oder wichtige Informationen, die schnell die Bevölkerung erreichen sollten, wurden neben einem Aushang im Rathaus durch Ausrufer verbreitet. Später kam dann das Radio hinzu, doch auch hier wurden eher überregionale Nachrichten gesendet.
Heinrichs Biografie
Er wurde 1865 in Alpen geboren und lebte in der damaligen Mauerstraße Nr. 8 (heute alte Kirchstraße) in direkter Nachbarschaft zu Familie Baltes in Nr. 7. Er war nicht verheiratet, hatte keine Nachkommen und lebte nahezu bis zu seinem Tode 1949 im elterlichen Haus. Während eines Krankenhausaufenthaltes im Alpener Krankenhaus Marienstift der Franziskanerinnen verstarb er. Sein Vater Ludwig Graeven betrieb im Hinterhof eine kleine Schusterwerkstatt. Heinrich erlernte ebenfalls den Schusterberuf, übte diesen aber später nicht weiter aus. In seiner Sterbeurkunde wird bei Heinrich Graeven als Beruf „Wegearbeiter“ genannt. Diese Berufsbezeichnung entspricht der heutigen Tätigkeit eines Arbeiters beim Bauhof der Gemeinde Alpen. Wie in den damaligen Zeiten auch andernorts am Niederrhein üblich, war er Bediensteter bzw. Arbeiter bei der Gemeinde und konnte so – aufgrund seiner Stellung – das Nebenamt eines Ausrufers ausüben. Ob es weitere Ausrufer in anderen Wohnvierteln oder Ortsteilen von Alpen gab, ist nicht überliefert.
Über Heinrichs Privatleben ist nur wenig bekannt, außer dass er sehr rege, über einen sehr langen Zeitraum und immer nur als Junggeselle, am Schützenleben des Junggesellen-Schützenvereins 1680 Alpen e. V. teilnahm. Im Mai oder Juni eines jeden Jahres wird seit nunmehr fast 343 Jahren am Pfingstwochenende das Schützenfest in Alpen gefeiert. Ein Foto (Bild 2) aus dem 300-Jahr-Jubiläumsbuch des Vereins belegt auf Seite 94, dass er im Jahr 1902, also im Alter von 37 Jahren Thronherr war, zusammen mit seiner Throndame Bella Waldor (zweites Paar rechts vom König) am Königsthron von König Adolf Osser mit Königin Christine Schreiber. Ein weiters Foto (Bild 3) aus dem Jahr 1927 zeigt ihn auf Seite 144, 62-jährig und schon sehr ergraut als Vorsitzender des Festausschusses.
Wer weiß schon, wie es früher wirklich war?
Woher habe ich, als Hobby-Historiker, meine Kenntnisse und wie kann man die Selbstbehauptung von Heinrich Graeven, der letzte Ausrufer Alpens gewesen zu sein historisch belegen? Nun, zunächst suchte ich nach seiner Geburts- und Sterbeurkunde, danach in amtlichen Niederschriften, im Archiv der Gemeinde Alpen. Im Falle Graeven belegt ein Ratssitzungsprotokoll vom 7.7.1922 die Erstattung von Krankenkassenbeiträgen durch die Gemeinde Alpen mit Nennung seines Namens und seiner Berufsbezeichnung Wegearbeiter.
Derartige Informationen zu Personen sind im Zuge des Datenschutzes normalerweise nicht zugänglich, d. h. sie bedürfen einer besonderen Genehmigung. Im Archiv der Gemeinde Alpen schlummert noch so mancher Schatz, der gehoben werden will. Eine weitere historische Methode ist die Befragung von Zeitzeugen, solange es noch lebende Beteiligte gibt.
Zwei erinnerungsstarke Zeitzeuginnen
Für detaillierte Auskünfte konnte ich zwei Zeitzeuginnen gewinnen, beide Alpener Urgesteine: Luise Pekel, geborene Kuhnen, und Else (Elisabeth) Theuner, geborene Baltes (meine Schwiegermutter! Die beiden waren lange Zeit Nachbarskinder in der damaligen Mauerstraße (heute Alte Kirchstraße) und wohnten später lange Zeit, ab 1955 im ersten Alpener Neubaugebiet nach dem Krieg, Im Heesefeld, nur wenige Meter voneinander entfernt.
Else war 1932 noch zu klein, um Heinrich Graeven selbst als Ausrufer erlebt zu haben. Das traf aber auf Luise Pekel zu. Sie wurde in den 1960er und 70er Jahren von den kleinen Kindern des Heesefelds, u.a. meiner Frau, liebevoll „Tante Lulu“ genannt wurde – Luise aus Sympathie und wohl auch wegen der immer bereitgehaltenen Lutscher. Wegen des hohen Alters der beiden Damen, zum Zeitpunkt der Befragung 99 und 90 Jahre alt, wurde ein Telefongespräch mit beiden verabredet, das am 15. November 2022, nur wenige Tage vor Luises 100. Geburtstag, stattfand. Außer mir auf der einen Seite war noch die Leiterin des Sozialen Dienstes des Evangelischen Altenzentrums Haus am Park, Xanten auf der anderen Seite anwesend und somit Zeugen des Gesprächs.
In ihrer bekannten, lauten und vorwitzigen Art kommentierte Luise die alte Geschichte mit den Worten: „Gräves Hen, dän schtoon doch ömmer mit sin schäll op et Krüz“. Sie bestätigte dabei auch, dass Heinrich Graeven für die Straßen des Viertels regelmäßig zu bestimmten Wochentagen und Tageszeiten die amtlichen Neuigkeiten ausrief. Um möglichst viele Bewohner im Wohnviertel zusammen-zurufen, benutzte er eine Handschelle, mit der er kräftig läutete. An der Kreuzung „et Krüz“, verlas er, sobald genügend Anwohner eingetroffen waren, die amtlichen Bekanntmachungen. Ob er das auch für weitere Viertel tat, war nicht zu ermitteln. Leider kannte auch sie nicht die Bedeutung von „Rätta Plü!“
Auch stumme Zeugen sprechen
Gemeint sind hier vor allem Fotos aus den alten Zeiten. Solange man noch erkennen kann, hinter welchen Gesicht welcher Erwachsene verbirgt, können auch Fotos historische Quellen sein. So zum Beispiel ein Foto (Bild 4) vom ersten Kinder-Schützenfest 1932 in Alpen, damals schon „Achter de Mur“ genannt, gemeint war damit der Hinterhof der Familie Melchers in der damaligen Mauerstraße 16. Achter de Mur ist auch noch heute der Name der dortigen Pumpennachbarschaft. Das Foto befindet sich ebenfalls im Jubiläumsbuch des Schützenvereins und zeigt unter anderen die 10jährige Luise Kuhnen und auch Theo Baltes, Elses acht Jahre älteren Bruder, zusammen mit seinem Cousin Hans van Rennings (mit Akkordeon), Maria Melchers (spätere Thiesies) sowie den damaligen Kurt Verhülsdonk. Damals als Kinder von 8-10 Jahren, interessierten sie sich nicht sonderlich für Nachrichten, dann eher schon für den etwas schrulligen Auftritt des Ausrufers Heinrich Graeven. Schon sein gewaltiger, gezwirbelter Schnurrbart aus der Mode der Kaiserzeit war Respekt einflößend.
Gelebte Traditionen und gelebtes Brauchtum
Aus diesem Kinderschützenfest hat sich in dem Viertel Alte Kirchstraße und Mauerstraße bis heute die Nachbarschaft in dem „Achter de Mur“ erhalten. Im Mai oder Juni eines jeden Jahres wird seit mehr als 340 Jahren am Pfingstwochenende das Schützenfest des Junggesellenschützenvereins Alpen gefeiert. Viele der Nachbarschaften feiern am Pfingstmontag, sozusagen Mitten im Frühling. Es ist zur Tradition geworden, dass die Einwohner Alpens auf den Straßen an diesem Tag zusammenkommen, um an meist festgelegten Orten, falls vorhanden sogar an einer Nachbarschaftspumpe, diesen Brauch zu pflegen. Auch in diesem Jahr beginnt das Fest bereits um 6:00 Uhr morgens mit dem Wecken durch die Schützen; dann das Setzen der Maien in den Nachbarschaften, Fahnen und Wimpel gehören mittlerweile auch dazu, ebenso wie die reichliche Versorgung mit Essen und (geistigen) Getränken, oft bis spät in die Nacht.
Als ich 1973 nach Alpen kam – der Liebe wegen – wurde ich an meinem ersten Pfingstmontag Teil dieses Brauchtums. Es war für mich fast so etwas wie ein Aufnahmeritus, sozusagen die „mystische Zulassung“ in eine festgefügte Nachbarschaft und als Alpener, obschon nicht hier im Ortsteil Alpen, sondern Menzelen-Ost, gebürtig. Dass dieses „erlernte Brauchtum“ auch für die Zukunft Bestand hatte, zeigte sich 1993, nach dem Einzug in unser neu erbautes Haus im Dahlacker. Hatte sich doch dort, unter Einbeziehung aller zugezogenen Neubürger schnell die Tradition einer Nachbarschaft gebildet. Bereits 2019 konnten wir unser 25jähriges Bestehen feiern und dabei unsere selbst errichtete, tatsächlich auch wasserspendende Schwengelpumpe, in Betrieb nehmen.
Wie lautete nochmal die Ausgangsfrage?
Was „Rätta Plü“ bedeutet, wissen wir immer noch nicht. Vielleicht weiß es ein Zuhörer oder Leser meiner Geschichte. Auch wenn es auf manche gestellte Frage keine Antwort gegeben hat, hat doch die Suche danach zu einem zwar bescheidenen, aber immerhin historischen Erkenntnisgewinn verholfen.
Dabei sind es oft die kleinen, eher unscheinbaren Dinge, Gerüche oder Worte, die uns antreiben, Geschichten aufzuschreiben. Erhaltenswerte Geschichten aus vergangenen Tagen sind daher fast immer bereichernd, sie fühlen sich warm und heimelig an. Wie sich in dieser Geschichte zeigt, sind sie auch ein Teil von uns selbst: eben Rätta Plü!
Verfasser: Karl (Carlo) Hofmann